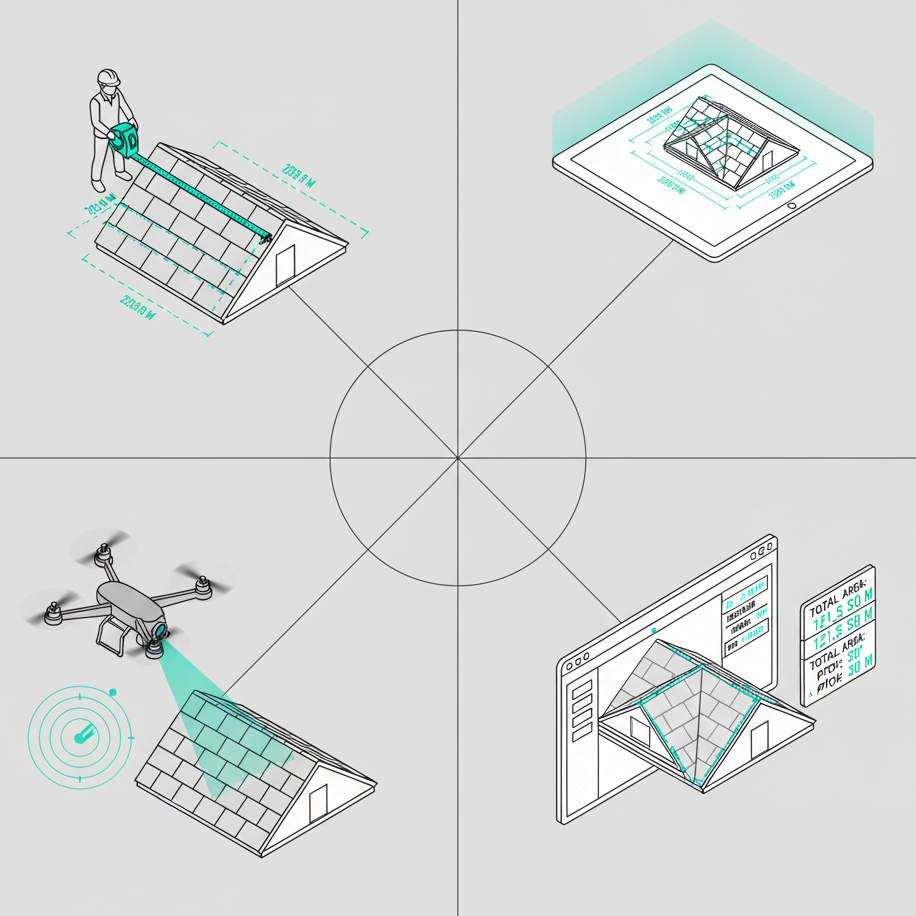Die wichtigsten Dachdecker Begriffe erklärt

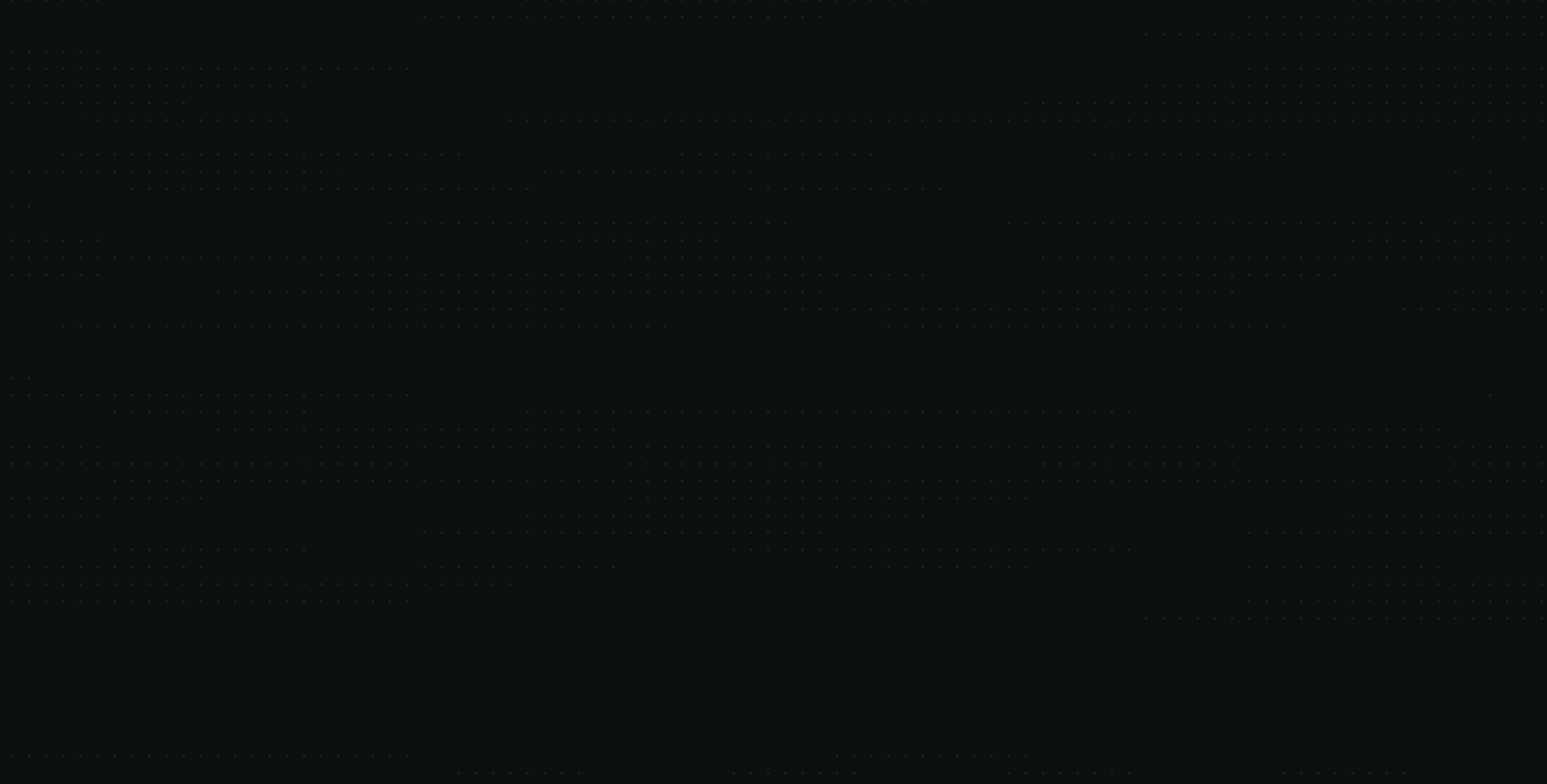
Was ist der First, Giebel und Grat, welche Dachformen gibt es und was sind die Vorteile eines Walmdachs? Lernen Sie jetzt Dachdecker-Begriffe kennen.

Aufschnüren (Arbeitsschritte)
Als Aufschnüren bezeichnen Zimmerer das Auftragen eines Profils auf einen sogenannten Reißboden. Dabei erstellen diese auf einem Bretterboden eine zweidimensionale Darstellung des Dachprofils im Maßstab 1:1. Sie legen die Bauteile auf und die Markierungen werden übertragen, angerissen und ausgearbeitet. Aufschnüren bezeichnet dabei das Zeichnen der Linien auf dem Reißboden. Die meisten Bauteile eines Daches sind sehr lang, häufig zehn Meter und länger, weshalb zum Zeichnen der Linien eine Schlagschnur genutzt wird. Aus Platz- und Zeitmangel kommt der Reißboden nur noch selten zum Einsatz. Stattdessen arbeiten Zimmerer heute mit dem sogenannten Rechnerischen Abbund und ermitteln die Maße und Winkel rechnerisch. Sie nutzen Abbundsoftware und Abbundmaschinen.
Dachform
Die äußere Form eines Daches wird als Dachform bezeichnet. Es gibt zahlreiche verschiedene Dachformen, dazu gehören unter anderem:
- Flachdach
- Satteldach
- Pultdach
- Walmdach
- Krüppelwalmdach
- Zeltdach
- Kegeldach
Dachhaut
Die äußere Schicht eines Daches wird als Dachhaut bezeichnet. Es handelt sich also um die Dacheindeckung, bei geneigten Dächern muss diese regensicher und bei flachen Dächern wasserfest sein. In Deutschland sind die Dachziegel die am häufigsten verwendete Eindeckungsart.
Dachstuhl
Wenn ein Dachtragwerk aus einzelnen Traggliedern zusammengesetzt ist und eine traditionelle Dachform ausbildet, wird das gesamte Gefüge in der Regel als Dachstuhl bezeichnet. Die meisten Dächer bestehen aus einem Dachstuhl und einer Dachabdeckung, auch Dachhaut genannt. Typischerweise besteht dies aus Holz, bei großen Gebäuden kann Eisen oder Stahlbeton verwendet werden. Der Dachstuhl trägt die Dachhaut.
First
Bei einem Steildach wird der obere Abschluss, dort wo die beiden Dachflächen in einer Linie aufeinandertreffen, als First bezeichnet. Spezielle Elemente schützen diesen Übergang besonders, beispielsweise mit Firstziegeln oder Firststeinen. Im Falle von Metalldächern werden passend gekantete Profile verwendet. Die Firstdeckung dient der Dachentlüftung und schützt vor eindringender Feuchtigkeit. Für die Entlüftung bauen Zimmerer spezielle Lüfterziegel ein. Das Verlegen der Firste erfolgt meist mit einer Firstgratrolle in Trockenbauweise, alternativ werden diese mit Dachdeckmörtel vermörtelt. Die Traufe bildet den Gegensatz zum First, als Ortgang bezeichnet man den seitlichen Abschluss.
Giebel
Die Giebel bezeichnen lediglich indirekt einen Teil des Dachs, es handelt sich dabei um die Wandflächen seitlich des Daches. Bei einem typischen Satteldach ist der Giebel eine dreieckige Fläche, meist ist hier genug Platz für den Einbau eines Fensters vorhanden. Sogenannte Krüppelwalmdächer haben einen trapezförmigen Giebel, Walmdächer haben keinen Giebel.
Grat
Die außenliegenden Verschneidungsflächen zweier Dachflächen werden als Grad bezeichnet. Nicht jedes Dach hat einen Grat, siehe auch Kehle. Dächer mit Grat (und Kehle) sind häufig über L-förmigen Grundrissen und bei Dächern mit Gauben zu finden.
Kehle
Die innenliegenden Verschneidungsflächen zweier Dachflächen bezeichnet man als Kehle, eine Dachkehle hat nicht jedes Dach. Siehe auch Grat.
Konterlattung
Die Quereinlattung zum Fixieren der Dachziegel oder vergleichbarer Materialien nennt man Konterlattung. Sie stellt die Belüftung unterhalb der Dachdeckung sicher.
Ortgang
Der Ortgang bezeichnet den seitlichen Dachabschluss, während der First den oberen Abschluss beim Steildach und die Traufe das untere Ende darstellt. Wie beim First schützen auch beim Ortgang spezielle Produkte die Dachkonstruktion, die auch einen optisch harmonischen Abschluss sicherstellen.
Pfetten
Die Pfetten sind Balken im Dachstuhl, die parallel zu Traufe und First verlaufen. Sie dienen häufig der Aussteifung der Sparren.
Satteldach
In der einfachsten Form besteht ein Satteldach an den Längsseiten eines Gebäudes aus zwei rechteckigen schrägen Flächen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einem Sparrendach und Pfettendach: Das Sparrendach ist eine traditionelle Dachkonstruktion, bei Gebäudebreiten von sieben bis acht Metern und einer Dachneigung von mehr als 30 Grad ist diese Konstruktion typisch. Eine Sonderform ist das Kehlbalkendach, das durch den Einbau eines Kehlbalkens entsteht. Damit lassen sich größere Spannweiten umsetzen. Hauptmerkmal des Pfettendaches sind die waagerechten Pfetten, die auf den geneigten Dachsparren aufliegen.
Sparren
Sparren sind Balken oder Träger des Dachstuhls, die von der Traufe zum First verlaufen. Diese tragen die Dachhaut und die gesamten Dacheindeckungsmaterialien. Dazu gehören je nach Dach die Dachziegel, Dachsteine, Schiefer, Dachplatten usw.
Traufe
Die Traufe stellt den Gegensatz zum First dar. Dabei handelt es sich um den unteren Abschluss der geneigten Dachfläche. Gleichzeitig stellt die Dachtraufe die Tropfkante des Dachs bei Regen dar. Aus diesem Grund erfolgt die Anbringung des Dachentwässerungssystems an der Traufe. Die Dachtraufe begrenzt die geneigte Dachfläche nach unten, der Dachfirst ist die obere Begrenzung. Der Schnittpunkt zwischen der Dachhaut und der senkrechten Außenfläche bezeichnet man als Traufpunkt. Den seitlichen Abschluss eines Dachs bezeichnet man als Ortgang.
Verfallung
Die Verfallung bezeichnet einen Grat bei zusammengesetzten Dachflächen, wenn der Grat von einem höheren First zu einem tiefer liegenden „fällt“.
Walmdäch & Krüppelwalmdach
Während beim klassischen Satteldach die schrägen Flächen an den Längsflächen des Gebäudes rechteckig sind, werden diese Seitenflächen beim Walmdach zu Trapezen. Wird an den schmalen Seiten statt einem Giebelteil in Dreiecksform eine dreieckige und ebenfalls geneigte Fläche angesetzt, entsteht ein komplett ausgebildeter Walm. Diese Fläche zieht sich beim Walmdach vom Dachfirst bis auf die Höhe der Regenrinnen. Wenn die Schräge des Walms weiter oben endet, wird die Dachform als sogenanntes Krüppelwalmdach bezeichnet. Das Krüppelwalmdach ist die häufigste Form des Walmdachs. Es verbindet die Vorteile des Walmdachs mit denen eines Satteldachs. Der Krüppelwalm schützt den Giebel vor der Wind und Wetter, erhöht die Stabilität des Daches und dient zugleich der optischen Aufwertung. Besonders beliebt ist diese Dachform in Regionen mit rauer Witterung. Nicht vertikal verlaufende Flächen leiten den Wind besser ab und die auf den Giebel drückende Windlast wird minimiert. Zugleich können Walmdächer und Krüppelwalmdächer in der Regel eine höhere Schneelast tragen.